John Belamy Foster: The Ecological Revolution. Making Pe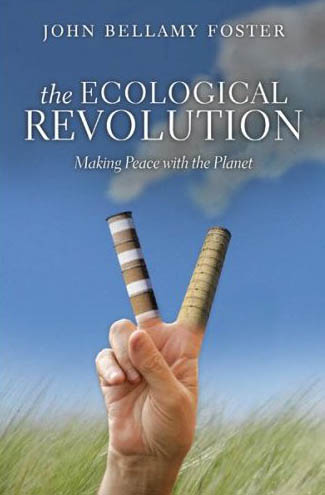 ace with the Planet. New York 2009. 328 S.
ace with the Planet. New York 2009. 328 S.
Die ökologische Krise als eine Krise des Kapitalismus anzusehen, ist seit langem ein zentrales Thema von Foster. Als Wissenschaftler und Herausgeber von Monthly Review wurde er zu einem der weltweit führenden Vertreter dieser Sichtweise. Das vorliegende Buch – dessen Untertitel gleichzeitig der Titel der letzten größeren Arbeit von Barry Commoner ist, den er einleitend würdigt – versammelt einige seiner wichtigsten Aufsätze zur ökologischen Krise aus den letzten zehn Jahren, die größtenteils aktualisiert und grundlegend überarbeitet wurden.
Foster verankert seine Sichtweise sorgfältig in den Arbeiten von Marx. So konnte er zeigen – bes. in seinem Opus Magnum Marx’s Ecology (2000) –, dass ökologische Sensibilität mitnichten eine Errungenschaft der letzten Jahrzehnte ist, sondern schon in der Bodenkunde des 19. Jh. vorhanden und wesentlich für die marxsche Analyse des Kapital war. Im Licht dieser Tatsache können produktivistische Marx-Klischees zurückgewiesen werden, die eine ungerechtfertigte Rückübertragung von Vorstellungen, die der Prioritätensetzung zu Zeiten der Sowjetunion entsprangen, widerspiegeln. Je mehr der Marxismus von diesem Ballast befreit wird, umso mehr empfi ehlt er sich als Impulsgeber für die notwendige ökologische Revolution.
Zu Beginn bringt Foster das gegenwärtige gesellschaftliche Dilemma scharf zum Ausdruck: »Capitalism as a world economy [...] embodies a logic that accepts no boundaries [...]. The earth as a planet, in contrast, is by definition limited« (15). Auf diesen grundlegenden Widerspruch reagiert das Kapital, indem es versucht, sich ein ›grünes‹ Gesicht zu geben – durch technologiebasierte und marktförmige Politiken. Foster kritisiert solche Ansätze, wie sie u.a. von Nicholas Stern, William Nordhaus und Thomas Friedman vorgebracht werden, eindringlich. Er weist darauf hin, dass pro-kapitalistische Ökonomen die unter Klimatologen bestehende Einigkeit über den Ernst der Klimakrise systematisch ignorieren. Diese Ökonomen seien der Ansicht, dass die Gesellschaft die durchs Kapital gesetzten politischen Schranken notgedrungen akzeptieren müsse – egal wie groß die sich daraus ergebende Gefahr für das Überleben der menschlichen Gattung auch immer ist (59f).
Diese Konfrontation zwischen denen, die die ökologische Krise anerkennen, und denen, die sie leugnen, bildet den Fokus des ersten Teils (»Die planetarische Krise«), der hauptsächlich politische Analysen enthält. Ein Kapitel über das Pentagon verdeutlicht, dass die politischen Entscheidungsträger in den USA sich des drohenden katastrophalen Klimawandels voll bewusst sind, v.a. auch der positiven Rückkopplungen im Klimasystem, die diesen wahrscheinlich weiter beschleunigen werden. Gleichzeitig bleibt die vorherrschende Strategie der Energieversorgung – wie im Kapitel über »Peak Oil und Energie-Imperialismus« gezeigt – auf »maximale Extraktion mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln« ausgerichtet (105). Foster liefert einschlägige Zitate aus links-liberalen Kreisen in Großbritannien und den USA, die auf einen umfassenden Konsens innerhalb der herrschenden Klasse bezüglich der geopolitischen Perspektive auf Energiesicherheit« hinweisen (104) – ein Konsens, der auch unter Obama fortbesteht. Soweit die herrschende Klasse die Notlage erkennt, sieht sie ihre Aufgabe weniger darin, einen Ausweg zu finden, als darin, auf den resultierenden gesellschaftlichen Zusammenbruch gut vorbereitet zu sein. Mittels Technologiepolitik und umweltpolitischer Reformen versucht das Kapital dennoch, dem unvermeidlichen Dilemma zwischen ökologischem Kollaps und (zu dessen Abwendung notwendiger) sozialer Revolution zu entkommen. Die Vorliebe des Kapitals für technologische ›Lösungen‹ diskreditiert Foster mit dem Hinweis auf das sog. Jevons-Paradoxon: Effi zienzfortschritte bei der Nutzung einer natürlichen Ressource werden gewöhnlich überkompensiert durch die daraus folgende vermehrte Nachfrage nach dieser Ressource, was unterm Strich zu einer Zunahme des Ressourcenverbrauchs führt. Infolge des öffentlichen Drängens auf umweltpolitische Reformen propagierte das Kapital eine Reihe illusorischer Auswege, wobei Foster aufzeigt, wie die großen Umweltgipfel sich stets fest im Griff von Konzerninteressen und deren marktbasierten Ansätzen wie Verschmutzungsrechte- und Emissionshandel befanden.
Der zweite Teil (»Marx’ Ökologie«) enthält Fosters wesentliche theoretische Arbeiten. Der politische Kern seines wegweisenden Aufsatzes »Marx’s Theory of the Metabolic Rift« (Kap. 9) von 1999 ist die von Marx übernommene Einsicht, dass die kapitalistische Entwicklung der modernen Industrie auf einem grundlegenden Bruch zwischen menschlicher Gattung und übriger Natur basiert – wobei der Aufsatztitel auf eine Stelle in Kapital III zurückgeht, in der Marx einen »unheilbaren Riss« im »gesellschaftlichen und durch die Naturgesetze des Lebens vorgeschriebnen Stoffwechsel« diagnostiziert, ausgelöst durch die Trennung der »beständig wachsenden, in großen Städten zusammengedrängten Industriebevölkerung« vom Land, infolge derer »die Bodenkraft verschleudert und diese Verschleuderung durch den Handel weit über die Grenzen des eignen Landes hinausgetragen wird« (MEW 25, 821). Für Marx bildet die ökologische Krise demnach das Grundprinzip bzw. die wesentliche Vorbedingung für die kapitalistische Produktionsweise. Die Anerkennung ökologischer Prioritäten ist also ein Herzstück der marxschen Kritik des Kapitals und muss dieser nicht erst hinzugefügt werden – wie etwa James O’Connor mit seiner These vom »Zweiten Widerspruch« behauptet (vgl. Kap. 10). – Daraus folgert Foster im dritten Teil »Ökologie und Revolution«), dass umgekehrt die Wiederherstellung intakter Naturverhältnisse nötig ist, um das Kapitalverhältnis zu überwinden: »the human relation to nature« liege »at the heart of the transition to socialism« (265).Revolutionärer Wandel hat also sowohl eine ökologische als auch eine politisch-ökonomische Dimension.
Victor Wallis
Aus dem Englischen von Oliver Walkenhorst